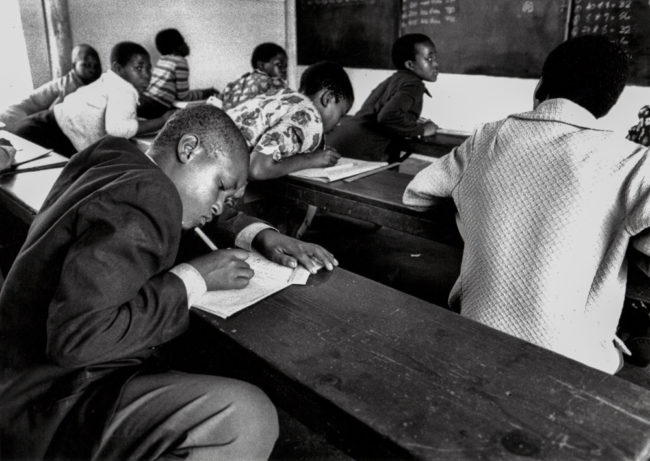Vom Schlendrian im Umgang mit der Sprache
von Eckhard Supp
Ein wenig fühlte ich mich an Karl Valentins – das „v“ wie ein „f“, bitte – „Semmelnknödeln“ erinnert. Hatte der Mensch in der Werbung da wirklich gerade die „Ziffernblättern“ (im Akkusativ) seiner Uhr angepriesen? Oder hatte ich es nur geträumt? Erstaunt hätte mich das nicht wirklich. War ich doch erst kurz zuvor über einen Werbespot gestolpert, in dem das korrekte „besser“ durch ein dümmliches „mehr gut“ ersetzt worden war.
Damals hatte ich mir noch die Frage gestellt, ob das nun ein Fehler oder absichtlich verballhornter „Werbesprech“ war, vielleicht gar der missglückte Versuch einer sprachlichen Persiflage; Fragen, die sich dann später, angesichts des Satzes „… bei Check 24, Deutschlands größtes Vergleichsportal …“ oder des Internet-Angebots, in dem für „rosanen Pfeffer“ geworben wurde, allerdings kaum noch stellten; genausowenig wie beim Staunen über die linguistisch-kulinarische Spitzenleistung „… nachdem wir … verspiesen haben …“.
Keine Angst! Es geht mir hier nicht darum, sozusagen als Oberlehrer der Stunde die fast unvermeidlichen Rechtschreib-, Grammatik-, Aussprache-, Syntax-, System- oder Stilfehler, die im Alltag jedem von uns hin und wieder unterlaufen, zu brandmarken. Vor solchen Fehlern war ja nicht einmal jener Oberstudienrat in der Talkshow gefeit, der in Unkenntnis des korrekten Konjunktivs meinte: „… als ob es geben würde …“. Sie werden wie viele andere meist als lässliche Sünden betrachtet, vor allem wenn sie aus freier Rede stammen; wie die Manie, „Parameter“ – korrekt: [paˈraːmetɐ] – oder auch die Namen ausländischer Sportler penetrant auf der falschen Silbe zu betonen.
Wie unvermeidlich solche Fehler sind, bewies – ein wenig unfreiwillig – schon vor vielen Jahrzehnten jener US-amerikanischer Millionär, der eine gigantische Summe für den Fall auslobte, dass ihm jemand ein vollkommen fehlerfreies Buch präsentierte; meines Wissens musste der Betrag nie ausgezahlt werden. Und auch in unseren Tagen können selbst Publikationen, die besonderen Wert auf gutes Deutsch legen, zahlreiche Lapsus nicht vermeiden, wie es eine Firma namens „Deutsches Lektorat“ – vielleicht wirtschaftlich nicht ganz uninteressiert – der Publikation „Krautreporter“ in triumphalistischem Ton nachwies: „296 Schreibfehler in 10 Artikeln von neun Autoren.“
Hinter all diesen sprachlichen Irrwegen stecken allerdings unterschiedliche Ursachen. Manchmal handelt es sich um den ganz normalen sprachlichen Wandel, wie er in allen Kulturen seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden stattfindet. Man denke nur an die vielen Wörter, die allein innerhalb Europas migrierten und immer noch migrieren. „Journalist“ und „Garage“ (Letztere mit Bedeutungswandel) aus dem Französischen zu uns, „Kindergarten“ und „Waldsterben“ von uns zu den Nachbarn. Unser „Oheim“ wurde dabei zum (französischen) „Onkel“, die „Base“ zur „Tante“. Sprachliche Veränderungen sind auch kein deutsches Problem oder eines der sozialen Medien, wie oft gemutmaßt: Die „nite“ statt der „night“ im amerikanischen Alltagsenglisch ist nur eines von unzähligen Beispielen.
Oder man denke an das, gerne als „Deppen-Apostroph“ belachte, aus dem Englischen stammende „Gitte’s“ oder „Willi’s“, das inzwischen sogar der Duden zu akzeptieren scheint. So, wie er auch die unschöne Verdopplung im „Super-GAU“ toleriert, und wie es inzwischen Mode geworden scheint, das im Deutschen zwar erlaubte, aber trotzdem nicht sehr elegante, eher ans Englische angelehnte „Tausende von Vögeln“ statt des feineren „tausende Vögel“ zu verwenden.
Schieres Unwissen scheint dagegen hinter der fast schon pathologischen Analogiebildung des Typs „im Juli diesen Jahres“ zum korrekten „im Juli letzten (nächsten) Jahres“ zu stecken. Viele, darunter ungezählte Sprachprofis auf unseren TV-Kanälen, scheinen zu vergessen, dass „letzten (nächsten) Jahres“ eine erlaubte Zusammenziehung von „des letzten (nächsten) Jahres“ ist. Da die Formulierung „des diesen Jahres“ allerdings kein Deutsch, sondern Kauderwelsch ist, ergibt auch eine Zusammenziehung keinen Sinn. Richtig muss es heißen „im Juli dieses Jahres“.

Dass wir Deutsche vor allem mit dem schönen Genitiv unsere Schwierigkeiten haben, hat schon Bastian Sick, Autor der legendären „Zwiebelfisch“-Kolumne des „Spiegel“ vor zwei Jahrzehnten nachgewiesen. Geholfen hat das nicht viel, sonst hätten wir nicht erst kürzlich wieder auf n-tv lernen dürfen, dass etwas „… aufgrund den Preiserhöhungen …“ der Fall war. Manchmal ist man versucht, zu glauben, der Genitiv komme dem einen oder andern zu hochgestochen vor, aber, Hand aufs Herz, glaubt jemand ernstlich, dass ein korrekter Satz schlechter verständlich sein könne als ein fehlerhafter?
Zum normalen sprachlichen Wandel – in der geschriebenen wie der gesprochenen Sprache – gehören auch Bedeutungsverschiebungen, so etwa beim sprichwörtlichen „wie die Faust aufs Auge“. In meiner Jugend bedeutete das, dass etwas gar nicht passte, denn wer wollte sich schon freiwillig eine (schmerzhafte) Faust auf dem Auge einhandeln. Heute ist der Spruch in der Regel positiv konnotiert, was die Frage aufwirft, ob sich Sprache ganz allgemein „brutalisiert“ hat. Diesen Eindruck erweckt auch so manche aktuelle Debatte, in und außerhalb der Medien, in der der politische Gegner gerne auch mal als „verwahrlost“ oder „kriminell“ diffamiert wird.
Eine solche Brutalisierung sollte man auf jeden Fall kritisch untersuchen und im Unterschied zu Infantilisierungen vom Schlage des „Wums“ oder „Doppel-Wums“ unseres Kanzlers, der seine Wähler allesamt für Vorschüler zu halten scheint, auch durchaus ernst nehmen. Sie könnte bedenkliche gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegeln. Vor allem von unseren Medien würde ich erwarten, dass sie einer solchen Brutalisierung nicht Vorschub leisten, nicht einmal durch unablässiges und genussvolles Zitieren entsprechender Politiker-Lapsus.
Damit wären wir am Punkt, an dem sprachlich eben nicht mehr alles „doch egal“ ist. Es ist richtig: Unsere Sprache verändert sich ständig. Solche Veränderungen, wenn sie denn dauerhafter Natur sind und nicht nur einer kurzweiligen Mode geschuldet, kommen meist leise, kündigen sich nicht an. Im Falle der sprichwörtlichen Faust auf dem Auge wurde ich, vielleicht verursacht durch einen längeren Auslandsaufenthalt, vom Bedeutungswandel einmal „kalt erwischt“, hatte keinen blassen Schimmer, was mein Gegenüber mir sagen wollte.
Den besten Beleg für die permanente Veränderungen des Deutschen bietet der Duden, dessen 28. Auflage 148.000 Stichwörter umfasst – 3.000 mehr als in der vorangegangenen Ausgabe und fünf mal so viele wie knapp anderthalb Jahrhunderte zuvor.
Auf einem ganz anderen Blatt stehen voluntaristische oder administrativ verordnete Sprachänderungen, wie sie etwa in Frankreich oder Italien im Kampf gegen Anglizismen immer wieder versucht oder zumindest gewünscht wurden. Mit mäßigem Erfolg, wie man in beiden Ländern feststellen muss, wobei sich in Frankreich wenigstens der „ordinateur“ gegen den „computer“ und das „logiciel“ gegen die „software“ durchsetzen konnten.
Einen solchen massiven administrativen Eingriff erlebte die deutsche Sprache mit der Rechtschreibreform der 1990er Jahre, die allerdings auch erst wirklich breite Akzeptanz fand, nachdem besonders absurde Vorschriften in den Nullerjahren wieder zurückgenommen und für viele der neuen Schreibregeln alternative Möglichkeiten zugelassen worden waren. So durften sich die leckeren Crêpes schlussendlich doch wieder schreiben wie in alten Zeiten und mussten sich nicht mehr mit trockenem Krepp(papier) verwechseln lassen. Regeln, wie der deutlich logischere und anwenderfreundlichere Gebrauch des „ß“, hatten sich da schon rascherer Durchsetzung erfreut.
Schon vor der Rechschreibreform hatte Deutschland mit der trendigen, so genannten „konsequenten Kleinschreibung“ gekämpft, die auch von literarischer und nicht literarischer Prominenz (Grimm, George, Jelinek und bereits seit 1925 die Künstler des Bauhauses) favorisiert wurde. Viel blieb von diesem Modetrend nicht übrig; nicht einmal die „gemäßigte“ Form der Kleinschreibung, die zumindest Eigennamen und Satzanfängen ihre Großschreibung – entstanden übrigens erst im Barock – belassen hatte.
Die Schwierigkeit, einen solchen voluntaristischen Wandel „amtlich“ zu verordnen, mag daher rühren, dass gerade das Lesen zum Gutteil eine Sache instinktiv ablaufender Reflexe ist, egal, ob man „vollständig“ oder „quer“ liest. Ein gutes Beispiel dafür sind die gelegentlich in den Social Media kursierenden Beiträge, mit denen bewiesen werden soll, dass Texte auch ohne jeglichen Vokal verständlich sind. Etwa so: „Wsstst d, dss s sgr Kltrn gbt, drn gsmt Schrft hn Vkl skmmt?“ (zitiert nach 100woerter.de). Mag sein, dass das stimmt, aber es soll mir niemand erzählen, dass er solche Sätze mit der selben reflexartigen Leichtigket lesen und verstehen kann, wie korrekt und vollständig geschriebene.
Voluntaristisch – für Kritiker auch willkürlich – sind die Änderungen, die derzeit unter dem Stichwort „gendern“ diskutiert werden. Zwar gehen erste Versuche in dieser Richtung bereits auf die feministische Bewegung der 1970er und 1980er Jahre zurück, wirklich in aller Munde – sogar in dem von Nachrichtensprechern unserer öffentlich-rechlichen Medien – aber ist diese Form des gewollt nicht-diskriminierenden Sprachgebrauchs erst seit etwa einem Jahrzehnt. Noch in der 22. Ausgabe des Duden aus dem Jahr 2000 gab es zwar den „Gendarmen“, nicht aber das „Gendern“.

Mit dem Gendern ist der Anspruch einer geschlechtergerechten Sprache verbunden, denn, so die Analyse, weil die Sprache ein Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse sei, wolle (und könne) man letztere eben auch mit dem Hebel der Sprache in Richtung größerer Gerechtigkeit verändern. Die Frage ist, ob sich die gesellschaftliche Realität wirklich durch eine voluntaristische, oktroyierte Sprachrevolution zum Besseren wandeln lässt.
Das ist umso mehr fraglich, als das Gendern im Alltag immer wieder auch zu bizarren Formulierungen führt. So, wie etwa das sicher gut gemeinte, aber dennoch absurde, im TV gehörte „Krankenschwester*innen“ oder auch die Variante jenes Sportreporters, der beim – ausschließlich von Männern gespielten – „Superbowl“ von „Spielerinnen und Spielern“ sprach.
Im gesprochenen Deutsch stellen das „Binnen-I“ und das „Gendersternchen“ ihre Adepten offenbar immer wieder vor unüberwindliche Hürden. Beide fallen nämlich besonders beim raschen Sprechen gerne einmal der Schludrigkeit anheim, und dann werden aus „Journalist*innen“ ganz rasch „Journalistinnen“; die männlichen Kollegen fallen flach. Genauso merkwürdig mutet es an, wenn eigentlich umgekehrt „gegendert“ werden müsste. Warum, bitte schön, sollte Albert Einstein EINE Koryphäe in seinem Fach gewesen sein. Müsste man das nicht als reziproke Diskriminierung bezeichnen, und hätte Einstein nicht genauso Anspruch auf EINEN „Koryphä“ oder „Koryphäer“ (nein, nicht „Pharisäer“) gehabt wie die Genderer auf ihr Sternchen?
Ob und in welchem Umfang sich das Gendern, anders als Kleinschreibung und „Krepp“ durchsetzt, bleibt abzuwarten. Das eine oder andere wird in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehen, Fragwürdiges oder Missverständilches darf wohl auch gerne wieder verschwinden. Am Ende gewinnt doch das, was die Kommunikation einfacher, effektiver und verständlicher macht. Es kommt bei Letzterer schließlich nicht so sehr darauf an, wieviel guter (politisch korrekter) Wille hinter dem Gesagten und Geschriebenen steckt, sondern was davon beim Zuhörer respektive Leser ankommt.
Denn eines ist klar: Problematisch werden sowohl all die oben beschriebenen Fehler wie auch das voluntaristisch „Progressive“ genau dann, wenn sie das Verständnis erschweren. Oder glaubt jemand ernstlich, der Satz, der in einem deutschen Magazin zu lesen war – „Jeff Bezos seine Mutter ihr Schiff wird …“ – sei wirklich auf Anhieb verständlich. Und was genau bedeutet es, dass die Stadt Jena „Bußgeldbescheide im Rahmen mit Impfpflicht“ verschickt. Weder ist klar, was ein Bußgeldbescheid mit Impfpflicht ist, noch erscheint das Verschicken teurer, weil gerahmter Bußgeldbescheide wirklich sinnvoll.
Dassselbe gilt für den „Bargeldabfluss“ anstelle eines wohl eigentlich gemeinten „Liquiditätsabflusses“ – da laufen ja keine Manager oder Banker mit Koffern voller Bargeld durch die Lande –, wie auch für die falsche Übersetzung des englichen „landmark“ – für architektonisch besonders hervorstechende Gebäude – mit „Landmarke“ anstatt mit „Wahrzeichen“, wie es richtig gelautet hätte. Eine Landmarke, und vielleicht erklärt das dem Hamburger Politiker einmal jemand, ist laut Wikipedia nämlich kein neues Universitätsgebäude mitten in der Stadt, das in diesem Fall gemeint war, sondern ein „auffälliges, meist weithin sichtbares topographisches Objekt. Es kann sich beispielsweise um Türme, Windräder, Burgen, Berge oder freistehende markante große Bäume handeln“, so weiß zumindest Wikipedia.
Kauderwelch, wie das zunehmend populäre „xy gehört zu einem der Höhepunkte des yz“ – ja zu welchem dieser vielen Höhepunkte denn? – muss man sich im Geiste erst übersetzen, bevor man ahnt, was gemeint sein könnte. Effektive Kommunikation? Denkste! Richtig grausam können Kommafehler dann werden, wie etwa der, der aus Opa, dem Mit-Esser – „Komm, wir essen, Opa!“ – das Kannibalismus-Opfer machen: „Komm, wir essen Opa!“.
In diesen Fällen wird nicht nur die Kommunikation erschwert, sondern hier fängt auch die Verantwortung derer an, die die Sprache pflegen sollten, anstatt sie zu verhunzen und unverständlich zu machen: Lehrer, Autoren, Redakteure, TV-Sprecher … Wenn man von jedem Handwerker verlangen darf, dass er sein Werkzeug nicht so lange verlottern lässt, bis ihm der Betonbohrer aus der Maschine ins Gesicht fliegt (und die Blutlache auf unserem Teppich landet), dann darf man diesen Anspruch wohl auch an Sprachprofis hinsichtlich der korrekten Behandlung ihres Werkzeugs, der Sprache nämlich, stellen.
Leider zeigen gerade viele Medienschaffende, die eigentlich ein geschärftes Bewusstsein für den richtigen Gebrauch der Sprache mitbringen sollten, hier große Ausfallerscheinungen. Wenn ein von „Deutschlandfunk.Kultur“ zitierter (ehemaliger) Chefredakteur des „Spiegel“ fragt: „Warum sollten Medienschaffende weniger Fehler machen, als andere Berufsguppen?“, dann hat er genau diesen Punkt nicht verstanden: Dass nämlich die (korrekte) Sprache das Handwerk des Medienschaffenden ist, und dass wir von ihm erwarten können, dass er mit ihr genauso sorgfältig und reflektiert umgeht, wie der Handwerker mit seiner Bohrmaschine. In beiden Fällen sind Unfälle sonst vorprogrammiert.
Nein, Rechtschreib-, Grammatik-, Aussprache-, Syntax-, System- oder Stilfehler bedeuten nicht das Ende unserer Kultur oder den Untergang des Abendlandes. Und die schon vor Jahrhunderten zu hörende Klage, die Jugend – wenn es denn man nur die wäre – beherrsche kein korrektes Deutsch mehr, kann selbst die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung nicht nachvollziehen. Diese Fehler sind einfach nur lästig, erschweren unsere ohnehin nicht leichte Kommunikation unnötig und gehören deshalb so weit wie möglich eliminiert. Nicht toleriert oder entschuldigt. Punkt!
Beim Klick auf die Fotos öffnet sich eine browserfüllende Ansicht.
Inhaltsverzeichnis enos-kultur
Gesamtverzeichnis enos-Magazin 2015 - 2023